unterscheid.bar
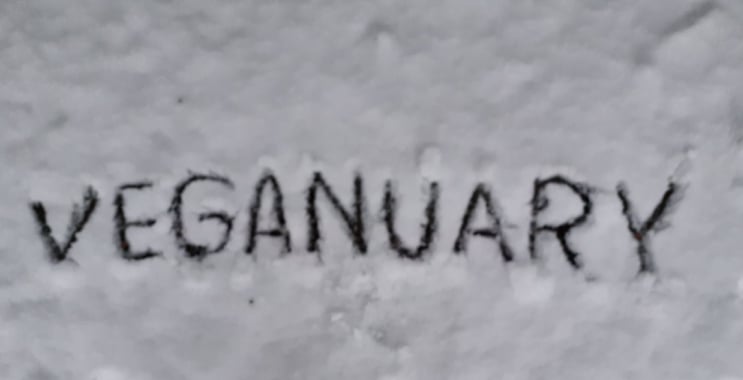
Veganuary Teil 6
Emily war nicht nur eine Gesetzesbrecherin, sie stiftete sogar die rechtschaffenen Bewohner*innen von Neuengland zu Falschaussagen und zur Behinderung der Justiz an. »Vierzig eiskalte Tage und Nächte lang versteckte sich Emily vor ihren Verfolgern in einem Waldgebiet um Hopkinton, einem kleinen Landstädtchen in Massachusetts. Die Anwohner*innen führten die Polizei mit falschen Angaben über Emilys Aufenthaltsort bewusst in die Irre.«
Nach ihrem natürlichen Tod wurde eine naturgetreue, lebensgroße Bronzestatue auf ihrem Grab errichtet. Für die Statue benötigte man viel Bronze, denn Emily wog zu Lebzeiten fast 700 Kilogramm. Trotz ihres Gewichts war es ihr gelungen, über den Zaun des Schlachthofs zu springen und wegzulaufen. Die amerikanische Psychologieprofessorin Melanie Joy erzählt die wahre Geschichte der Kuh Emily und ihrer abenteuerlichen Flucht im letzten Kapitel ihres Buchs »Warum wir Hunde lieben, Schweine essen und Kühe anziehen« – um Hoffnung auf eine Welt zu wecken, in der wir Hunde, Schweine und Kühe gleichermaßen lieben.
In den ersten Kapiteln geht Melanie Joy der Frage nach, warum wir das bisher nicht tun, sondern einen willkürlichen Unterschied zwischen diesen Tieren machen. »Wir lieben Hunde nicht deshalb und essen Kühe nicht deshalb, weil Hunde und Kühe von Grund auf unterschiedlich wären – Kühe haben genauso Gefühle, Vorlieben und ein eigenes Bewusstsein wie Hunde –, sondern weil wir sie als unterschiedlich wahrnehmen. Und infolgedessen nehmen wir auch ihr Fleisch unterschiedlich wahr.«
Den wenigsten Menschen sind Tiere egal, weshalb sie den Gedanken an Tierleid vermeiden. »Im Rahmen meiner Forschung wie auch privat haben mir buchstäblich Tausende Menschen bestätigt, dass sie ein ungutes Gefühl dabei hätten, wenn sie beim Verzehr von Rindfleisch tatsächlich an eine lebende Kuh denken würden.« Falls diese Tiere dennoch thematisiert werden, dann suggeriert die Werbung Bauernhofidylle mit grasenden Kühen und scharrenden Hühnern.
Die Tierrechtsorganisation PETA besucht eine Zeugin der angeblichen Hühneridylle, die ehemalige Legehenne Rudi, die von Karen Duve aus der Halle einer Bio-Freilandhaltung befreit wurde: Unter Rudis kritischem Blick schildert die Autorin von »Anständig essen« Beispiele, wie brutal und respektlos Tiere den Haltungsbedingungen angepasst werden. Ihre schmerzempfindlichen Schnäbel werden so achtlos abgehackt, dass die Hühner kaum noch essen können.
Timothy Cummings, Tierarzt und Professor an der Mississippi State University rät Geflügelproduzent*innen dazu, das Schnabelkürzen beschönigend »Schnabelpflege« zu nennen, als handelte es sich um Hühner-Wellness. Der US-Viehzuchtverband NCBA empfiehlt seinen Mitgliedern, »statt von ›Schlachtung‹ besser von ›Verarbeitung‹ oder ›Ernte‹ zu sprechen, da ›die Menschen auf das Wort schlachten negativ reagieren.‹« Die Verbandszeitschrift »British Meat« plädiert für eine neue Verkaufsphilosophie: »Wir müssen unsere Kund*innen dazu bringen, dass sie an das denken, was sie essen werden, nicht an das Tier auf der Weide.« (zitiert von Melanie Joy)
Als Karen Duve einen Artikel zur Massentierhaltung schreibt, bittet der Redakteur um sprachliche Änderungen, »ich möge doch bitte den Satz ›Kinder essen wir am liebsten‹ durch ›Jungtiere essen wir am liebsten‹ ersetzen.« Der britische Schriftsteller Aldous Huxley warnte: »Tatsachen schafft man nicht dadurch aus der Welt, indem man sie ignoriert.« Sie werden auch nicht schöner, indem man sie beschönigt: Die »Jungtiere« leiden unter der »Schnabelpflege« so wie die Tierkinder unter der Verstümmelung ihrer Schnäbel, und sie überleben die »Ernte« ebenso wenig wie das Schlachten.
»Muss ich noch erwähnen, dass der Artikel nie gedruckt worden ist? Ich verstand das nicht. Schließlich handelte es sich um eine liberale, respektable und überregionale Zeitung, die sich meines Wissens auch nicht durch Werbebeilagen der Fleischerinnung finanzierte. Warum war es so ungeheuer wichtig, dass ein Tierkind nicht Kind, sondern Jungtier genannt wurde?« (Karen Duve: »Anständig essen. Ein Selbstversuch«) Der Sprachkritiker Wolf Schneider sieht in der Abstraktion eine Taktik, um zu verschleiern, was Anschaulichkeit enthüllen würde: »Wer wird schon zehn Putzfrauen kündigen, wenn ihm der Satz ›Freisetzen von Rationalisierungspotentialen im Dienstleistungsbereich‹ zur Verfügung steht?« (Wolf Schneider: »Deutsch für Kenner. Die neue Stilkunde«)
Melanie Joy bittet in ihren Universitätsseminaren regelmäßig die Psychologiestudierenden, typische Eigenschaften von Hunden und von Schweinen zu nennen. Hunde werden mit Adjektiven wie »niedlich« oder »treu« assoziiert, bei Schweinen denken die Studierenden an »dreckig« und »schwitzen«. Dass Schweine gar keine Schweißdrüsen besitzen, hatten einige zwar schon mal irgendwann gehört, aber gleich darauf wieder vergessen. Nach dem Grund gefragt, warum Schweine gegessen werden, Hunde aber nicht, antworten sie gleichlautend: »Keine Ahnung, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Weil es halt einfach so ist, denke ich.«
»Wir schicken die eine Tierart zur Schlachterei und schenken der anderen unsere Liebe und Aufmerksamkeit. Und der einzige Grund, der uns dafür offenbar einfällt, lautet: ›Es ist halt einfach so.‹ Wenn unsere Einstellung und unser Verhalten gegenüber Tieren derart widersprüchlich ist und diese Widersprüchlichkeit derart unhinterfragt bleibt, dann können wir mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass man uns etwas Absurdes eingetrichtert hat. Es ist absurd, dass wir Schweine essen und Hunde lieben und nicht einmal wissen, warum.«
Melanie Joy fordert ihre Leser*innen dazu auf, die Lücke zwischen ihren Wertvorstellungen und ihrem Verhalten zu schließen, sich ihr Mitgefühl zurückzuerobern und ihren Mut. Dafür gibt es ein gewichtiges Vorbild: »Genau wie Emily können wir uns entschließen, aus der Reihe auszubrechen und unser Leben in neue Bahnen zu lenken.«